Ansichten
vom Aufbau der Salzburger Universitätskirche
(In: Von Österreichischer Kunst. Ritter Verlag, Klagenfurt
1981, S.105-112)
(Abbildungen in Arbeit)

Der
herausragenden Bedeutung der Salzburger Universitätskirche und
ihrer einmaligen Erscheinung hat man manchmal mit ohnmächtigen
Metaphern zu begegnen versucht: „Wann solche Bau-Art sollt ein
Teutscher Greis erblicken, Er wußt nicht, wo er wär? er
thät darob erschrikken", hieß es schon 1701, während
der Bauzeit.(1) „Verweilt man nachts
vor der Kollegienkirche, so kann der Eindruck entstehen, irgendein
Urwelttier setze sich stampfend in Bewegung.“ (2)
Manche Architekturgeschichte erwähnt das Meisterwerk nicht einmal
oder streift es nur nebenbei. Der oft erwähnte Grund dafür
liegt in der Sonderstellung des Baues, der sich aus historischen Vorbildern
nicht ableiten läßt, auch wenn es vor allem für die
Entfaltung des Grundrisses mannigfache Anregungen aufzuzeigen gab.
So ist das, was wir heute über die Kollegienkirche (3)wissen,
mehr als sonst monographischer Natur, sodaß Querverbindungen,
Analogien, Ableitungen hinter der Beschreibung des heutigen Baues
und dessen sorgfältig ausgebreiteten Planungsphasen zurücktreten.
Im systematischen Studium von Grundriß, Aufriß, Innenraum,
Doppelturmfassade, Choranbau, Kuppel und städtebaulicher Anordnung
ist eine besondere Eigenschaft untergegangen: der Aufbau.
Eine erste Annäherung mag die bildlich dokumentierte Rezeptionsgeschichte
der Alten Ansichten erlauben. Die hier sichtbar werdenden Schwierigkeiten
liegen vor allem in zwei Momenten: einerseits in der Beziehung von
Fassade und Baukörper, andererseits in den Größenverhältnissen.
Johann Friedrich Probst (Fuhrmann, Taf. 28) (4)
gibt die Fassade frontal wieder und zeigt den als Basilika interpretierten
Baukörper aus der Perspektive seitlich herausgeklappt. Dieses
Hilfsmittel wird immer wieder eingesetzt (vgl. Fuhrmann, T. 29, 41).
Wenn Jakob Strucker Anfang des 19. Jahrhunderts ,Salzburg gegen Süden'
(Fuhrmann, T. 64) skizziert, erscheint ihm die Kollegienkirche überhaupt
als orientalischer Zentralbau. Diese Tendenz ist immer da bemerkbar,
wo die Größenverhältnisse schwanken. So bei A. F.
H. Naumann (Fuhrmann, T. 44), der den Teil zwischen Giebel und Kuppel
auf ein Minimum reduziert und die Kuppel dadurch drückt, daß
er Ochsenaugen anstelle der hohen Rundbogenfenster erfindet. Doch
kann auch der entgegengesetzte Fall eintreten, daß die Baumassen
so übertrieben werden, daß der sonst überlegene Dom
dagegen zurückbleibt, wie bei Johann Jakob Strüdts Ansicht
um 1807 (Fuhrmann, T. 62). Dabei mißversteht er zugleich die
Fassade, indem er das Dach anstelle des Giebels nach vorne zieht.
Umgekehrt läßt W. F. Schlotterbeck (um 1805) die Kollegienkirche
im Vergleich zum Dom in der Dächerlandschaft versinken (Fuhrmann,
T. 58, vgl. T. 92).
Dom und Fischer-Kirchen
Jakob Alt hat etwas später diesen Fehler korrigiert (Fuhrmann,
T. 76). Aber von Südosten her wird der Unterschied zum Dom, dessen
drei Chorkonchen in diese Richtung steil aufragen, nicht deutlich.
Sogar die topographisch genaue Sicht Hubert Sattlers von Nordwesten,
die das Herausragen des Baukörpers der Kollegienkirche wiedergibt,
nimmt eine ähnliche Lösung für den Dom an (Fuhrmann,T.91).
Aber dessen Mittelschiff erhebt sich nur wenig über die Pultdächer
der Kapellen heraus und wird durch Ochsenaugen belichtet. Beim Dom
ist die Marmorfassade unabhängig vor den Nagelfluh-Bau geblendet;
die Dächer schneiden an der Rückseite willkürlich ein,
die Chorlösung setzt einen neuen Akzent, auch wenn im unteren
Teil die Fensterordnung weitergeführt wird.
Alle diese Bestimmungen treffen für die Kollegienkirche nicht
zu. Sowohl das Verhältnis von Fassade zum Baukörper wie
das von unten nach oben unterscheiden sich davon grundsätzlich.
Während beim Dom der eigentliche Baukörper als Verbindung
zwischen Fassade und Chor mit Kuppel fungiert, liegt bei der Kollegienkirche
der Akzent nicht in deren Tiefenerstreckung, sondern in einer von
der Polarität Fassade Chor gerahmten Höhendimension, die
analog für den Innenraum immer betont worden ist. Über der
Dachzone der Stadtlandschaft liegt, von einem Kranzgesims abgesetzt,
ein eigener gegliederter Bau, gewissermaßen eine in die Ferne
wirkende Kirche. Die historischen Vergleichsmöglichkeiten erweisen
sich aus dieser Sicht nur als bedingt gültige Anrequngen. Die
Idee eines AUFBAUES hat sich bei Fischer von Erlach selbst herausgebildet.
 Die konkav
einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer
Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums
nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende
Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden
Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß
diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um
eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf
dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,
T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende
Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme
strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten
Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich
in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die
Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein
dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.
Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse
und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.
Die konkav
einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer
Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums
nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende
Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden
Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß
diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um
eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf
dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,
T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende
Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme
strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten
Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich
in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die
Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein
dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.
Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse
und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.
Auf dem Stich Erzbischof Graf Thuns mit seinen Stiftungen ist zu sehen,
daß auch an der Johannesspitalskirche ursprünglich eine
Kuppel geplant war. In der kurzen Spanne 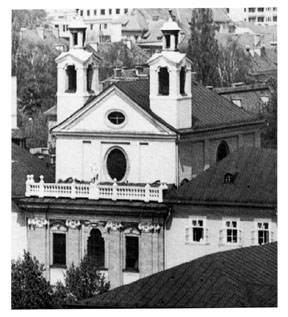 bis
zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer
wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf
Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser
Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen
deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter
dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich
dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.
Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der
Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem
unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier
ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,
hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im
Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister
die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung
wert zu finden. (6) Ebhardt spricht
von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den
Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner
sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß
der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert
als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)
Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,
den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der
Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.
bis
zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer
wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf
Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser
Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen
deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter
dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich
dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.
Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der
Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem
unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier
ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,
hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im
Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister
die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung
wert zu finden. (6) Ebhardt spricht
von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den
Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner
sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß
der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert
als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)
Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,
den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der
Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.
Im Gegensatz zur Dreifaltigkeitskirche entspricht nicht nur das erste
Geschoß den seitlichen Trakten. In der Anlage ist die gesamte
Fassadenhöhe wie ein Mittelrisalit durch eine Kolossalordnung
zusammengefaßt. Diese zweigeschossige Fassade nimmt gewissermaßen
die profane Basis für die darüberliegende Kirche ein.
Die Forschung hat auf die ähnliche Lösung der Fassade des
Oratoriums Sanctae Crucis bei S. Giovanni in Laterano hingewiesen,
was umso näher lag, als dort ebenfalls eine Johanneskirche zugleich
dem Salvator geweiht war. Die beiden Türme aus dem 14. Jahrhundert
erscheinen hinter der manieristischen Kolonnaden-Vorhalle. Doch setzt
Fischer die Erinnerung plastisch durch die Errichtung eines AUFBAUES,
der in Rom völlig fehlt, um. Auch auf der Rückseite im Nordwesten
wird durch ein umlaufendes Kranzgesims die Allusion des AUFBAUES beibehalten.
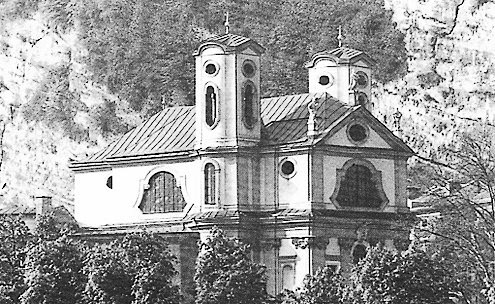 Zur gleichen
Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine
andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen
Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt
von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,
jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem
Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten
aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden
die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche
mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper
mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil
der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt
(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,
während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des
AUFBAUES aufzufassen ist.
Zur gleichen
Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine
andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen
Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt
von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,
jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem
Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten
aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden
die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche
mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper
mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil
der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt
(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,
während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des
AUFBAUES aufzufassen ist.
Mag das wichtigste Motiv für Fischer auch die Durchlichtung des
Innenraumes gewesen sein, so war es doch nicht zwingend, die AUFBAUTEN
so prägnant als autonome Gebilde auszuarbeiten. Die Idee ist
unabhängig von seinem sonstigen Werk entstanden.
Aufbauten im Frühwerk Fischers v. Erlach
Das genetisch aus Vorbildern nicht ableitbare Prinzip des AUFBAUES
der Salzburger Kirchen Fischers wird durch einen Blick auf seine frühen
Entwürfe erhellt. (9) Der zentrierte
AUFBAU wird als eine Konstante im Frühwerk sichtbar: Am Entwurf
für ein ,grosses Landgebäude' (,Bergschloss') haben „die
beiden ovalen Stallgebäude ... ungegliederte Aufsätze, die
sich mit den Bauten nicht verbinden. Die kleinen Aufbauten  darüber
wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)
im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist
von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)
„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen
Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der
ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend
wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"
;(12) am ,Mailänder
Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -
wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit
großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.
Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze
Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,
das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft
über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)
„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand
... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)
Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:
Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder
H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in
eine andere Richtung" ausbiegt.(15)
Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale
Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit
er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und
des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft.
darüber
wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)
im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist
von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)
„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen
Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der
ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend
wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"
;(12) am ,Mailänder
Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -
wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit
großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.
Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze
Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,
das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft
über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)
„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand
... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)
Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:
Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder
H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in
eine andere Richtung" ausbiegt.(15)
Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale
Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit
er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und
des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft.
Wie sehr Fischer dazu tendiert, die Aufbauten als etwas eigenes zu
betrachten, zeigt sich an zwei Entwürfen für Gartenhäuser,
wo sie nur mit einigen Linien angedeutet sind.(16)
Das ,Herabschweben' wird schon früh anschaulich: „Sein erster
großer Wurf ... der Ahnensaal des Geschlechts der Althan in
Schloß Frain ..., der wie eine Fata Morgana ... herabgeschwebt
zu sein scheint ...".(17) Schließlich
läBt sich „die Krönung des Mittelteils durch einen
durchsichtigen Aufsatz" (18)auch
für Schloß Schönbrunn anführen.
Aufgrund der topographischen Situation Salzburgs und der jeweiligen
Bauaufgabe war Fischer gezwungen, die Kirchen hochzuziehen, sollten
sie sich in ihrer Umgebung behaupten. Diese Bedingung traf sich mit
seinem, in zahlreichen Entwürfen für profane Gebäude
geübten Prinzip des AUFBAUES, indem er die Kuppelvorstellung
durch dieses ersetzte (Johannesspitals- und Ursulinenkirche) oder
mit ihm verband (Kollegienkirche).
Begrenzte Auswirkungen der Kollegienkirche
 Während
sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche
innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche
nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze
und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,
indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.
Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache
Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur
Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der
,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)
ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade
nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche
,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze
umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen
Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich
ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu
sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen
auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster
Während
sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche
innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche
nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze
und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,
indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.
Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache
Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur
Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der
,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)
ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade
nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche
,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze
umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen
Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich
ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu
sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen
auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster
 Weingarten
(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)
als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige
Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare
Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich
an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken.
Weingarten
(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)
als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige
Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare
Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich
an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken.
Der entscheidende Unterschied zu den genannten Beispielen liegt in
der Verlequng der Kolossalordnung in die Obergeschosse. Dadurch wird
das Kranzgesims in die Dachzone über die drei Fassadengeschosse
gehoben. Die Giebelfelder sind wieder traditionelle, flache Bekrönungen,
die nur in seitlichen sphärischen Segmenten zurückschwingen.
Eine Durchbrechung der Fassade im dritten Stock zwischen den Türmen
und der gewölbten Mitte ist dadurch nicht mehr möglich.
Die Fassaden liegen daher wie gewohnt als geschlossene Fronten vor
den Baukörpern. Bezeichnend ist, daß ein Entwurf für
Ottobeuren, der das Vorbild der Kollegienkirche getreuer übernommen
hätte, nicht ausgeführt worden ist.
 Die Baukörper
der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden
und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die
Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne
Fischers mangelt.
Die Baukörper
der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden
und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die
Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne
Fischers mangelt.
Die „zahlreichen Krönungen der Türme, deren Sinn es
ist, ,Bewegung nach allen Richtungen auszudrücken' (Alois Riegl)
(21) sind bei der Kollegienkirche nicht
nur gegen den Himmel durch die nach- oben schwingenden Bogenbalustraden
offen, sondern verbinden die vier Seiten auch durch die in den Diagonalen
angeordneten, auf Voluten stehenden Postamente mit den Skulpturen.
Die auch auf dem Giebel befindlichen Steinkugeln unterstreichen die
allseitige Ausrichtung. Das Motiv der stehenden Ochsenaugen, das es
nur am AUFBAU - an der Fassade, an der Kuppel, am Chor und in erweiterter
Form an den Seiten - gibt, bindet die auseinanderliegenden Komponenten
assoziativ zusammen.
Eine analoge Funktion nimmt das Queroval in der Ursulinenkirche wahr,
das jeweils im oberen Teil der Türme, der Fassade und an den
Seiten erscheint. Die im Gegensatz zur Kollegienkirche nicht allseitig
offene Ausrichtung der Bauanlage erfährt einen Akzent durch die
Abdachung der Türme, die gegen die Schmalseiten der Fassade und
des Chores als Dreiecksgiebel, dagegen in den Längsseiten als
Segmentbögen erscheinen; die parallel dem Längsbau entsprechenden
Turmseiten sind darüber hinaus vorgewölbt und auch in den
unteren Geschossen durchlichtet. Die breiten Lyra-Fenster an allen
Seiten öffnen den AUFBAU und fassen ihn zugleich zusammen. Eine
derartige Differenzierung ist den süddeutschen Vergleichsbeispielen
fremd, ja sie wirken dagegen plump und massiv.
Die von Sedlmayr angeführten Schwierigkeiten beim Betrachten
der Schauseite der Karlskirche sind auch bei der Kollegienkirche zu
beachten. „Ihr Sehen ist von der weithin wirkenden Tendenz des
19. Jahrhunderts erfaBt worden, alles - im räumlichen wie im
geistigen Sinn - flacher zu sehen als die Meister des Barocks, flacher
und stückhafter ... Wer im Sehen die ,Fassade' in die Fläche
plättet, der kann nie zu einer vollen Anschauung des Werkes kommen
... Denn diese ,Schauseite' ist eben keine ,Fassade' in dem Sinne
wie die vieler römischer Barockkirchen, die wirklich nicht mehr
sind als ein architektonisches Relief .. " (22)
Anstelle der anschließenden profanen Trakte der anderen Salzburger
Fischer-Kirchen tritt bei der Kollegienkirche eine äußere
Enge, der gegenüber sich die Fassade plastisch behauptet. Die
Kolossalordnung übernimmt dadurch eine ambivalente gelenkhafte
Rolle. Sie ist zugleich Unterbau für das Oben wie eine Antwort
auf den profanen Umraum. Diese Würdeform bildet nicht die Mitte
einer Architekturflucht, sondern muß sich eigenständig
durchsetzen, ohne genügend Distanz einer fernsichtigen Betrachtung
vorzufinden. Gleichzeitig antwortet sie dem Chor, wodurch ein tragfähiges
Gefüge entsteht, auf dem der zweigeschossige Giebelteil (mit
einem Giebel im Giebel) sich ohne Behinderung durch die Türme
nach den Seiten zu einer hohen Region einer ,Oberkirche' zusammenschließt.
Das AUFBAU-Konzept ist in allen Planungsphasen - in den Anfängen
sogar stärker - festzustellen. (23)
Die Fassade bietet auch, allein schon durch die von vorne nicht sichtbare
Kuppel, den Anlaß, den gesamten Bau aus anderen Perspektiven
zu sehen. Aus der Fernsicht wäre eine Durchbrechung der über
die Dächer der Stadt ragenden Kirche mit weiteren Ovalfenstern
(24) einem Verzicht auf deren architektonische
Glaubwürdigkeit gleichgekommen, so wünschenswert eine zusätzliche
Belichtung der Gewölbezone im Inneren auch gewesen sein mag.
Synthese
Schon für den Ahnensaal von Schloß Frain ist bemerkt worden,
er sei „bewußt mit der Landschaft entworfen worden."
(25) Auch Fischers Entwürfe für
Parktore und Vasen offenbarten „einen grundsätzlichen Aspekt
seiner Einstellung zur Architektur, die Absicht, seine Bauten als
in die Natur eingebettet aufzufassen." (26)
Vom selben Willen, eine Transformation von Natur in Kunst zu bewirken,
ist auch die ,Unterwerfung des Steines' (27)
durch die aus den Wänden des Mönchsberges herausgebrochenen
Zuschauergalerien der Sommerreitschule getragen. Grundsätzlich
müßten Fischers Bauten im Kontext der Stadt und der Landschaft
gesehen werden. „Alle seine Bauten wurden mit Bezug zu ihrer
natürlichen und künstlichen Umgebung entworfen. Sie waren
nicht als ihrer Umgebung untergeordnete, sondern als sich in sie dicht
einfügend geplant, um dieser eine neue Erscheinung und Bedeutung
zu geben. Fischer wollte, daß seine Kirchen und Paläste
Natur intensivierten und perfektionierten, ein Vorhaben, das letztlich
religiös war und aus seinem Glauben an Gottes universelle Ordnung
kam." (28) Der Vorgängerbau
der Ursulinenkirche war 1669 durch einen Felssturz zerstört worden.
„ Noch zwei Jahre danach barg man Tote aus dem Häuser- und
Felsenschutt. Die Tragik liegt auch darin, daß man die Felswand
als Bestandteil der schützenden Bastionen angesehen hatte."
(29)
Das ambivalente Bedeutungsspektrum des Felsens wird sich unter diesem
Eindruck von der gerade für Salzburg seit jeher wichtigen Bedeutung
eines Fundaments der Kirche zu der einer bedrohlichen Naturgewalt,
die es zu bezwingen gilt, verschoben haben. Die Rustika, wie die der
Dreifaltigkeitskirche, wurde im Gegensatz zu den Ordnungen darüber
(opera di mano) traditionell als ,opera di natura' bezeichnet. Aus
dieser Sicht erhebt sich die Ursulinenkirche gegen den Fels in die
Höhe. Von der Stadt her schwebt ihr AUFBAU über den Dächern
und erscheint vor dem felsigen Hinterprund als Kunst-Natur-Bild. Ähnliches
gilt für die Kollegienkirche, die noch heute im Stadtbild gegen
die Landschaft des Mönchsberges aufragt, und dies wurde, wie
die Rottmayrsche Ansicht auf dem Altarblatt des hl. Karl Borromäus
(30) bestätigt, auch im Barock
so verstanden.
Der Dom hingegen war noch selbst die veranschaulichte Metamorphose
des Steins, aus welchem er gebaut und ungeputzt sichtbar ist, was
durch den Gegensatz zur Marmorfassade noch deutlicher wird.
Auch wenn die AUFBAUTEN als eine weitgehend selbständige gehobene
Architektur aufgefaßt werden können, sind sie nicht ohne
den eigentlichen Kirchenbau, dessen Gewölbezone sie jeweils ummanteln,
denkbar. Dem sichtbaren Phänomen kommt keine getrennte Sphäre
ikonologischer Bedeutung zu. Die städtebauliche Situation hat
zu ihrer Entwicklung geführt wie seine in den besprochenen Entwürfen
nachweisbare Anlage. Durch die AUFBAUTEN wirken die Kirchen als Fernbild.
Natur und Architektur verbinden sich in dieser für Fischer eigentümlichen
Weise genauso wie Unten und Oben. Wie sehr diese Verbindung geglückt
ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, daß das polare Prinzip
des AUFBAUES nie beschrieben worden ist, obwohl sich in ihm die seit
jeher gerühmte plastische Kraft Fischers, die oben in alle Richtungen
über die Sichtachsen hinausweist, am klarsten ausdrückt.
(34) Die ,Synthese' als für den
Barock zentrale Eigenschaft (32) zeigt
sich auch in der möglichen analytischen Auseinandersetzung, ohne
daß die ,vermählende Kraft' der künstlerischen Fügung
dadurch geschwächt würde. Im Gegenteil: „Daß
aus dieser Kombination von so Heterogenem nichts Gestückeltes
entsteht, sondern ein Werk aus einem Guß, macht die Größe
von Fischers erster Synthese großen Stils aus". (33)
Das wird auch an vermeintlichen Schwächen (wie der Johannesspitalskirche)
anschaulich.
Anmerkungen:
1 ) Salzburger Museumsblätter, 6. Jg., 1927, Nr. 6, Sp. 2
2) Harald Keller: Die Kunst des 18. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte
Bd. 10, Berlin 1971, S. 86
3) Die Bezeichnungen ,Kollegienkirche' und ,Universitätskirche'sind
seit jeher unterschiedslos verwendet worden. In Kontrakten mit der
Hofbaumeisterei ist von ,der neuen Collegikürchen in Frauengarthen'
und der ,Universitetskhürchen' die Rede. Österreichische
Kunsttopographie Bd. IX, 1912, S.237, 240
4) Franz Fuhrmann: Salzburg in alten Ansichten. Salzburg 3. Aufl.
1981
5) Moritz Dreger: Zu den Salzburger Kirchenbauten Fischers von Erlach.
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte Bd. Vl. (XX.),; 1929, S.326:
„ Es ist sehr leicht möglich, daß erst die Verschiebung
der Flügel (im Plane) das Zurücktreten des Oberteils der
Kirchenfassade ergeben hat".
6) Hans Sedlmayr: Johann Bernhard Fischer von Erlach. Wien 2. Aufl.
1976, S.108
7) Manfred Ebhardt: Die Salzburger Barockkirchen im 17. Jahrhundert.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte Bd. 354, Baden-Baden 1975, S.126
8) Johannes Neuhardt: Aedes Sacra- Kunsthistorische und theologische
Gedanken. Markuskirche Salzburg (Ursulinenkirche) Generalsanierung,
Salzburg 1980, S.1
9) Die strenge Scheidung zwischen Profan- und Sakralbauten erscheint
mir in unserem Zusammenhang nicht förderlich. Martin Stankowski:
Die Kollegienkirche in Salzburg und ihre Voraussetzungen. Wiener Jahrbuch
für Kunstgeschichte Bd. XXIX, 1976, S. 179: „Morphologische
Erkenntnisse der Gleichzeitigkeit verwandter Bildungen im Sakral-
und Profanbau können allenfalls Aufschlüsse über Schaffensphasen
oder Datierungsmöglichkeiten erbringen, erlauben jedoch nicht,
Vorbilder über die Grenzen der Gattungen zu suchen". Auch
Lorenz scheut sich nicht in seinem differenzierten Überblick
„Das ,Lustgartengebäude' Fischers von Erlach", Wiener
Jahrbuch für Kunstgeschichte Band XXXII, 1979, S.59-76, eine
„prinzipiell ähnliche Gestaltung" zwischen einem Lustgartengebäude-Entwurf
und der Fassade der Kollegienkirche festzustellen.
10) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.52
11) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 88
12) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 93
13) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 92. 14) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.
92
15) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 95. Nach Hellmut Lorenz (zit. Anm.
9) steht die ,Mailänder Variante' am Anfang der Entwicklung.
16) Sedlmayr (zit. Anm. 6), Abb. 63, 65. Die Tendenz, Aufbauten in
schwächerem Strich zu zeichnen, läBt sich auch bei Bernini
boobachten, wie an seinem wegweisenden ersten Entwurf für die
Ostfassade des Louvre (1664), nicht aber bei Borromini. Das verweist
auf die spezifische Unterscheidung der Aufsätze, soll aber nicht
den Einfluß Borrominis negieren. Dazu: Renate Wagner-Rieger:
Borromini und Österreich. Studi sul Borromini, Atti del Convegno
promosso dall'Accademia Nazionale di San Lucca, Vol. Il, Rom 1967,
S.223 f.
17) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.9 f., vgl. S.49
18) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.96
19) Franz Fuhrmann, in: Reclams Kunstführer Österreich II,
Stuttgart 4. Aufl, 1974, S.581
20) Hans Sedlmayr: Die Kollegienkirche in Salzburg. Christliche Kunststätten
Österreichs Nr. 120, Salzburg 1980, S.11
21) Ebda.
22) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.175
23) In der Planungsphase 2 (s.: Hans Sedlmayr: Neue Ergebnisse zur
Kollegienkirche. Jahrbuch der Universität Salzburg 1977-79, S.97-111
) gleicht der Fassaden-AUFBAU noch dem der Johannesspitalskirche.
In Phase 3 mit dem rechteckigen Vorbau tritt er mit den Türmen
dahinter zurück. Erst in der Endphase verschmelzen durch die
Wölbung der Fassade alle Geschosse zu einer Fläche.
24) Sedlmayr (zit. Anm. 23)
25)
Hans Aurenhammer: J. B. Fischer von Erlach. London 1973, S.44
26) Aurenhammer (zit. Anm. 25), S.41
27) Ulrich Nefzger: Salzburg und seine Brunnen. Salzburg-Wien 1980,
S.20
28) Aurenhammer (zit. Anm. 25), S.165
29) Nefzger (zit. Anm. 27), S.152
30) Erich Hubala: Johann Michael Rottmayr. Wien - München 1981,
Abb. 307
31) Wurzeln der ,Aufbauten', ,Oberstöcke' oder ,belvedereartigen
Aufsätze' bei Schloßbauten verweisen in unterschiedliche
Kunstlandschaften. Dazu: Erich Hubala: Henrico Zuccallis SchloBbau
in Schleißheim, Planung und Baugeschichte 170~1740. Münchener
Jahrbuch für Kunstgeschichte 1966, Anm. 18. Die historischen
Zusammenhänge auch mit Vorformen kirchlicher ,Aufbauten' in Böhmen
(z. B. Wallfahrtskirche Unserer lieben Frau, 1617-1623, in Altbunzlau)
wären eigens zu untersuchen.
32) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.219-223
33) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.221

 Die konkav
einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer
Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums
nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende
Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden
Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß
diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um
eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf
dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,
T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende
Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme
strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten
Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich
in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die
Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein
dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.
Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse
und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.
Die konkav
einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer
Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums
nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende
Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden
Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß
diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um
eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf
dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,
T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende
Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme
strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten
Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich
in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die
Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein
dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.
Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse
und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.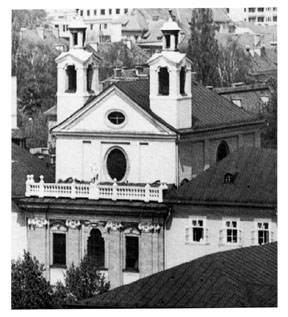 bis
zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer
wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf
Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser
Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen
deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter
dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich
dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.
Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der
Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem
unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier
ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,
hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im
Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister
die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung
wert zu finden. (6) Ebhardt spricht
von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den
Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner
sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß
der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert
als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)
Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,
den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der
Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.
bis
zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer
wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf
Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser
Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen
deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter
dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich
dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.
Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der
Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem
unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier
ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,
hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im
Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister
die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung
wert zu finden. (6) Ebhardt spricht
von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den
Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner
sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß
der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert
als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)
Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,
den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der
Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.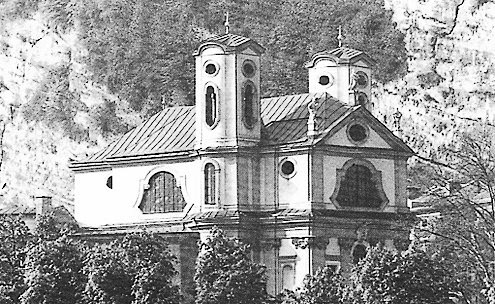 Zur gleichen
Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine
andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen
Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt
von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,
jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem
Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten
aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden
die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche
mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper
mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil
der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt
(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,
während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des
AUFBAUES aufzufassen ist.
Zur gleichen
Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine
andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen
Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt
von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,
jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem
Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten
aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden
die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche
mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper
mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil
der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt
(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,
während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des
AUFBAUES aufzufassen ist. darüber
wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)
im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist
von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)
„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen
Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der
ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend
wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"
;(12) am ,Mailänder
Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -
wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit
großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.
Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze
Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,
das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft
über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)
„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand
... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)
Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:
Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder
H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in
eine andere Richtung" ausbiegt.(15)
Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale
Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit
er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und
des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft.
darüber
wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)
im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist
von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)
„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen
Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der
ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend
wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"
;(12) am ,Mailänder
Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -
wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit
großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.
Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze
Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,
das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft
über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)
„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand
... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)
Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:
Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder
H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in
eine andere Richtung" ausbiegt.(15)
Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale
Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit
er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und
des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft. Während
sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche
innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche
nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze
und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,
indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.
Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache
Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur
Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der
,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)
ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade
nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche
,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze
umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen
Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich
ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu
sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen
auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster
Während
sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche
innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche
nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze
und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,
indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.
Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache
Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur
Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der
,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)
ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade
nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche
,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze
umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen
Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich
ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu
sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen
auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster
 Weingarten
(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)
als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige
Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare
Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich
an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken.
Weingarten
(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)
als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige
Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare
Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich
an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken. Die Baukörper
der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden
und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die
Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne
Fischers mangelt.
Die Baukörper
der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden
und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die
Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne
Fischers mangelt.