|
Die
Allegorien des Mark Tansey
(Anleitung zu einer Dekonstruktion der Moderne)
NOEMA Art Journal Nr. 43, Januar/Februar 1991, S.23-33
Mark Tanseys Bildwelt täuscht einfach. Da reitet ein Trupp über
den Horizont, kämpfen zwei Männer auf einem Felsen in einer
Schlucht, zeichnet ein Ureinwohner ein Strichmännchen an die Höhlenwand,
überqueren Menschen auf verschiedene Art und Weise einen Abgrund,
rauscht ein Wasserfall, zieht ein Mann seine Jacke aus.
Wer lange genug sucht, wird vielleicht die zitierten Bildquellen aus
Gemälden, Fotos und Werbung finden. In allen Bildern aus dem Jahr
1990 finden sich darüberhinaus Textspuren, zunächst aus dem
Buch Blindness and Insight, dessen Titel immer wieder auftaucht.
Paul de Mans nie ins Deutsche übersetzte, erstmals 1971 erschienene
Blindheit und Einsicht ist die Bibel der dekonstruktivistischen
Literaturwissenschaft. In den neuesten Gemälden werden Passagen
aus Jacques Derridas Grammatologie benützt.
Tansey
zwingt den Betrachter, diese Texte im Original zu lesen, da sie in den
Bildern verwischt, wiederholt oder nur bruchstückhaft zitiert werden.
Man fühlt sich genötigt, (zumindest) die Doppelseite 146-147
aus dem Buch de Mans zu studieren. (Der Maler zeigt dem distanziert
Schauenden sogar schließlich die Zahl 146, also in welche Seite
sich der Reader, der Leser buchstäblich zu vertiefen
hat). Selbst für diejenigen, die sich den asketischen Übungen
der Konzept-Kunst unterzogen haben, ist diese Art der Textexegese ungewohnt.
Der Weg der Interpretation führt von der unmittelbaren Anschauung
der leicht erkennbaren Motive zur Lektüre von komplizierten Theorien
und müßte in einer Kehrtwendung wieder zum jeweiligen Bild
zurückführen.
Dieser Pfad wird nur selten beschritten. Die Bilder stellen ihre Fragen,
und wenn keine Antworten erfolgen, kommt kein Dialog zustand. Jedes
Gespräch verlangt nach gewissen Regeln, damit es entstehen kann.
Im folgenden werden einige angeboten, um die Gedankenwelt eines Künstlers
vorzustellen, dem die Errungenschaften der Moderne zuwider sind, der
aber auch Rezepte zu ihrer Überwindung anbietet.
Hier kann nur der Plan eines Labyrinths skizziert werden, in das der
Maler die Betrachter lockt. Er will malen, was sich nicht malen läßt.
"Allegorie" bedeutet wörtlich "anders sagen".
Eine Allegorie zeigt nicht direkt, was sie meint. D. h. umgekehrt, daß
das Gezeigte nicht das Gedachte aussagt, sondern etwas anderes. "Dekonstruktion"
zerlegt einen Text, ein Bild, eine Architektur, um hinter den Fassaden
aufzudecken, wie sie nicht nur formal, sondern von der Konstruktion
her funktionieren. Es wird das dem Erbauer unbewußte Prinzip gesucht.
"Modern" ist oder war die Auffassung, daß nicht die
Vergangenheit, sondern nur die Gegenwart eine Orientierung bieten soll.
Nicht die Tradition sei das Vorbild, sondern das noch Unbekannte-Neue.
Nach dieser Vorstellung gibt es einen Fortschritt in den Gestaltungen,
aber auch in den Erkenntnissen. In den Bildern der letzten Jahre hat
Tansey die sich militärisch gebärdenden Modernen für
die Zerstörung der Kunst verantwortlich gemacht. Jetzt predigt
er die Erinnerung.

Derrida stellt de Man in Frage (Derrida queries de Man).
Im Bild geht es handgreiflicher zu als in seinem Titel. Da raufen zwei
Männer um ihr Leben. In einer Schlucht tänzeln sie auf einem
Felsvorsprung, auf dem vertikal der Buchtitel Blindness and Insight
prangt. Gemäß der Stichvorlage von Sidney Paget aus dem
Jahr 1893 (freundlicher Hinweis von Frauke Heuer) wird Sherlock Holmes
in die Reichenbachfälle abstürzen.
 Wer
Derridas, seinem 1983 verstorbenen, "geliebten Freund" Paul
de Man gewidmetes Buch Mémoirs liest, wird vergeblich
nach einer Infragestellung suchen. Im Gegenteil, es ist eine Lobpreisung
der herausragenden Bedeutung des in den USA zum Literaturpapst avan-cierten
Belgiers. Er erinnert sich an den Toten - umso mehr, als er selbst als
Begründer des Dekonstruktivismus dessen Anreger war und zu einer
zentralen Denkergestalt unserer Tage wurde. Die
Erinnerung an den Freund wird zur Argumentationsebene für die Rolle
der "Erinnerung" in den Schriften de Mans. Er scheint den
hinterlassenen Lebenden so sehr zu faszinieren, daß er "Das
Scheitern des Gedächtnisses... (als) kein Scheitern" empfindet
und konzediert, daß " es für Paul de Man, den großen
Denker des Gedächtnisses, nur Gedächtnis gibt, daß aber
eine Vergangenheit im buchstäblichen Sinne nicht existiert."
Das ganze Buch versucht das Wesen des Freundes in dessen Fähigkeit
der Interpretation mit Hilfe des Vergessens zu umreißen. Von einem
im Bildtitel anklingenden Zweifel kein Wort. Doch
dann passierte das Schreckliche. Die Feuilletons der Weltpresse breiteten
de Mans Vergangenheit als eines mit den Nazis kollaborierenden, antisemitische
Artikel verfassenden Autors der Jahre 1940-42 aus. Bezieht sich Tansey
also auf eine, nach dieser Aufdeckung eintretende Distanzierung Derridas?
Stellte dieser nun seinen toten Freund in Frage und begab sich dabei
in eine ihn selbst gefährdende Situation? Wer
Derridas, seinem 1983 verstorbenen, "geliebten Freund" Paul
de Man gewidmetes Buch Mémoirs liest, wird vergeblich
nach einer Infragestellung suchen. Im Gegenteil, es ist eine Lobpreisung
der herausragenden Bedeutung des in den USA zum Literaturpapst avan-cierten
Belgiers. Er erinnert sich an den Toten - umso mehr, als er selbst als
Begründer des Dekonstruktivismus dessen Anreger war und zu einer
zentralen Denkergestalt unserer Tage wurde. Die
Erinnerung an den Freund wird zur Argumentationsebene für die Rolle
der "Erinnerung" in den Schriften de Mans. Er scheint den
hinterlassenen Lebenden so sehr zu faszinieren, daß er "Das
Scheitern des Gedächtnisses... (als) kein Scheitern" empfindet
und konzediert, daß " es für Paul de Man, den großen
Denker des Gedächtnisses, nur Gedächtnis gibt, daß aber
eine Vergangenheit im buchstäblichen Sinne nicht existiert."
Das ganze Buch versucht das Wesen des Freundes in dessen Fähigkeit
der Interpretation mit Hilfe des Vergessens zu umreißen. Von einem
im Bildtitel anklingenden Zweifel kein Wort. Doch
dann passierte das Schreckliche. Die Feuilletons der Weltpresse breiteten
de Mans Vergangenheit als eines mit den Nazis kollaborierenden, antisemitische
Artikel verfassenden Autors der Jahre 1940-42 aus. Bezieht sich Tansey
also auf eine, nach dieser Aufdeckung eintretende Distanzierung Derridas?
Stellte dieser nun seinen toten Freund in Frage und begab sich dabei
in eine ihn selbst gefährdende Situation?
Keinesfalls.
Obwohl Derrida die Kunst des Vergessens so deutlich in das Zentrum des
Denkens von de Man gestellt hatte, schien er nachträglich gar nicht
zu fassen, wie recht er damit hatte. Er schreibt eine Fortsetzung: Wie
Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel. Derrida denkt gar nicht
daran, de Man in Frage zu stellen. Bei aller Skepsis und Verletztheit
geht er zum Gegenangriff über. Man müsse die Dinge lesen,
die de Man nicht geschrieben habe, man sollte ihn überhaupt
genauer lesen, man hätte die damaligen (von de Man so kunstvoll
vergessenen) Zusammenhänge der Kriegsjahre zu rekonstruieren. Derrida
verrät seinen Freund nicht, und jeder kann in den Lektüren
dieser von einem jammernden Ton begleiteten Argumentationskette festzustellen
versuchen, ob Derrida in dieser existentiellen Situation auf seine eigene
Methode der Dekonstruktion verzichtet oder nicht, ob er sich selbst
untreu wird, nur weil er einem Toten die Treue hält.
Tansey
stellt dar, was nicht passiert ist, der Titel sagt etwas ganz anderes
als das Bild. Die beiden tanzen über dem Abgrund. Warum diese Schlucht?
Bedeutet das, daß Derrida de Man in Frage hätte stellen müssen,
um nicht das Menuett mit einem Toten zu riskieren?
Das
Rätsel läßt sich ohne den Bild-Text nicht lösen.
Die beiden sind in ihrem letzten Tango auf einem Eckstein verschränkt,
von dem der Buchtitel Blindness and Insight hinabzieht. Der Dekonstruktivismus
begreift die Allegorie als "Eckstein", als eines die Konstruktion
bestimmenden Teilstückes, das nicht wie ein Schlußstein den
Bau vollendet, sondern von Anbeginn wie ein blinder Fleck im Auge des
Künstlers verborgen ist. Als Plattform für die Pirouette des
Paares hat Tansey einen Text eruiert. Es ist nicht der blinde Fleck
des Bildes, denn der Maler zeigt ihn genau. Die beiden immer wieder
von Tansey zitierten Seiten des Buches handeln vom Begriff der Moderne,
der von de Man in freier Auslegung Nietzsches in der Spontaneität
des Lebens, zugleich aber im Vergessen der geschichtlichen Vergangenheit
gesehen wird.
Indem
Tansey die Betrachter seiner Bilder dazu anleitet, sich dieser Theorie
des Vergessens als Basis der Moderne zu versichern, zwingt er uns zu
einer antimodernen, nämlich erinnernden Interpretation. Indem der
Bild-Text über das Vergessen undeutlich und verwischt erscheint,
wird die Rekonstruktion nötig und dem Text widersprochen. Oder
als Anregung einer weiteren Interpretation: Nicht Derrida stellt de
Man in Frage, sondern Tansey Derrida, weil der de Man nicht vergessen
kann, obwohl er sich krampfhaft an dessen Theorie des Vergessens klammert.
Der Maler empfiehlt sich der Tradition und ruft in die Stille: "Vergeßt
die Moderne!"
In
diesem Ringelspiel der Bedeutungen gelangen wir zum Thema des Tanzes.
Die beiden Genies kämpfen weniger, als sie Walzer tanzen. Nicht
daß es dadurch ungefährlicher wäre, aber die Regeln
sind andere - sie führten konsequenterweise zu den von Derrida
und de Man diskutierten Äußerungen Jean Jaques Rousseaus
über das Verhältnis von Musik und Malerei. Darüberhinaus
aber bestimmen sie die Sprache de Mans. Hamachers Einleitung "Unlesbarkeit"
schwelgt deshalb in den entsprechenden Begriffen: "Tanzfigur",
"Einmarsch", "Eiertanz", "Stechschritt"
usw.
De
Mans letztes Werk galt der Interpretation von Kleists Über das
Marionettentheater. Es schließt mit der: "... Falle der
ästhetischen Erziehung, die unvermeidlich der Zerstückelung
der Sprache durch die Kraft der Buchstaben mit der Anmut eines Tanzes
verwechselt. Dieser Tanz, ob er nun als Spiegel, als Nachahmung, als
Geschichte, als das Gefecht der Interpretation, oder als anamorphische
Transformation von Tropen erscheint, ist die letzte Falle, ebenso unvermeidlich
wie tödlich."
Tansey
tritt den Gegenbeweis an. Nur der die Buchstaben des Bildes nicht entziffernde
Betrachter gerät in Versuchung, den Text mit dem Tanz zu verwechseln.
Vielmehr hält er den tanzenden, im Gefecht der Interpretation mit
Derrida verstrickten, toten de Man "nachahmend" in der ästhetischen
Falle. Wie das Vorbild zeigt, handelt es sich um den letzten, detektivisch
nicht mehr zu bewältigenden Fall vor dem Absturz.
Jedes
der 1990 entstandenen Bilder Mark Tanseys ist eine Allegorie des Lesens.
Sie erschließen sich nicht im Entziffern der undeutlichen Texte,
sondern bedeuten als ästhetische Fallen für den Betrachter
etwas anderes. Da Derrida de Man nicht in Frage gestellt hat, wird er
seinem Freund, der das Vergessen predigte, untreu. Indem Tansey auch
seine Bildtitel dem Dekonstruktivismus entnimmt und sie im Illusionismus
seiner Bildwelten verbirgt, konstruiert er eine Gegenwelt.
 Auf
der Brücke über die Cartesianische Kluft (Bridge
Over The Cartesian Gap) versucht jeder monologisch seine Haut auf
andere Weise zu retten, als ob man mit einer Leiter, im Huckepack, mit
einem Kanu, laufend, Schubkarren schiebend, als Handwerker oder Geschäftsmann,
angesichts der Unendlichkeit der Welt allein die geringste Chance hätte.
Tansey illustriert den Wahn des neuzeitlichen Denkens, die individuellen
Versuche, den "Weg" der Erkenntnis für sich selber zu
finden. Descartes bevorzugte Wander- und Reisemetaphern. Auf
der Brücke über die Cartesianische Kluft (Bridge
Over The Cartesian Gap) versucht jeder monologisch seine Haut auf
andere Weise zu retten, als ob man mit einer Leiter, im Huckepack, mit
einem Kanu, laufend, Schubkarren schiebend, als Handwerker oder Geschäftsmann,
angesichts der Unendlichkeit der Welt allein die geringste Chance hätte.
Tansey illustriert den Wahn des neuzeitlichen Denkens, die individuellen
Versuche, den "Weg" der Erkenntnis für sich selber zu
finden. Descartes bevorzugte Wander- und Reisemetaphern.
Im
Feindlichen Einfall (Incursion) sprengt der avantgardistische
Vortrupp über den eigenen Horizont dem Ziel des Textes entgegen,
ihn aber durch die staubaufwirbelnde Hatz zu einem Bild verunklärend.
Wieder sehen wir uns der Dialektik des Gedächtnisses gegenüber.
Der Text von de Man über das notwendige Vergessen als Kennzeichen
der Moderne wird als Utopie der Beteiligten erinnert. Das Bild entsteht
aus der Demonstration, daß diese Art des modernen Vergessens nur
monochrome Nebelschwaden und tropfende Farbspuren hervorgebracht hat.
Nicht das Mitreiten, sondern die Distanz dazu ermöglicht im klärenden
Blick das Bild.
 Die
ohne Sicherung den Fels erklimmende Bergsteigerin scheint den Text vor
lauter Buchstaben nicht zu sehen. Genaues Lesen (Close Reading)
kann nicht den Zusammenhang deutlich machen, daß zwar der Felsen
sich verändert, der darauf (unten) lesbare Text sich (oben) wiederholt.
In Allegorien des Lesens schreibt de Man über neuere Literaturwissenschaften:
"... doch in keinem von ihnen sind die Beschreibungs- und Interpretationstechniken
weiter entwickelt als die Techniken des close reading in den
30er und 40er Jahren. Formalismus, so scheint es, ist eine alles-verschlingende
und tyrannische Muse; die Hoffnung, man könne technisch originell
und gleichzeitig in seiner Darstellung gewandt sein, wird von der Geschichte
der Literaturwissenschaft nicht bestätigt." Sie
wird aber von der Malerei demonstriert. Die "Muse" steigt
ohne Haken und Seil in der sicherungslosen Weise des "free climbing"
"technisch originell... und gewandt" auf. Der Maler aus Distanz
sieht mehr als der beste Literaturwissenschaftler und sogar besser als
die formalistische "Muse". Tansey illustriert nicht Paul de
Man, sondern zeigt die Grenzen dekonstruktivistischer Textualität
durch anschauliches Sehen auf. Ganz altmodisch ficht er einen Wettstreit
der Künste (Paragone) aus. Die
ohne Sicherung den Fels erklimmende Bergsteigerin scheint den Text vor
lauter Buchstaben nicht zu sehen. Genaues Lesen (Close Reading)
kann nicht den Zusammenhang deutlich machen, daß zwar der Felsen
sich verändert, der darauf (unten) lesbare Text sich (oben) wiederholt.
In Allegorien des Lesens schreibt de Man über neuere Literaturwissenschaften:
"... doch in keinem von ihnen sind die Beschreibungs- und Interpretationstechniken
weiter entwickelt als die Techniken des close reading in den
30er und 40er Jahren. Formalismus, so scheint es, ist eine alles-verschlingende
und tyrannische Muse; die Hoffnung, man könne technisch originell
und gleichzeitig in seiner Darstellung gewandt sein, wird von der Geschichte
der Literaturwissenschaft nicht bestätigt." Sie
wird aber von der Malerei demonstriert. Die "Muse" steigt
ohne Haken und Seil in der sicherungslosen Weise des "free climbing"
"technisch originell... und gewandt" auf. Der Maler aus Distanz
sieht mehr als der beste Literaturwissenschaftler und sogar besser als
die formalistische "Muse". Tansey illustriert nicht Paul de
Man, sondern zeigt die Grenzen dekonstruktivistischer Textualität
durch anschauliches Sehen auf. Ganz altmodisch ficht er einen Wettstreit
der Künste (Paragone) aus.
Im
Rückblick der sich (im Bildvordergrund kaum sichtbaren) hinter
ihren  Begriffstrümmern
verschanzenden Haudegen erscheint jenseits des durch die Schlachten
der Avantgarde zerstörten und von Schrift-Panzern durchfurchten
Tales des Zweifels (Valley of Doubt) die Montagne de St.
Victoire des Paul Cézanne als Ikone einer ersehnten Besinnung.
Otto Steinerts Foto Schlammweiher 2 (1953) bildet die Vorlage
eines durch Industrie vernichteten Bodens. Doch wie beginnt man noch
einmal? Das Wesen der Malerei, so lautet Tanseys Antwort, liegt im nicht-malbaren
Ursprung. Was kann man alles nicht zeigen! Begriffstrümmern
verschanzenden Haudegen erscheint jenseits des durch die Schlachten
der Avantgarde zerstörten und von Schrift-Panzern durchfurchten
Tales des Zweifels (Valley of Doubt) die Montagne de St.
Victoire des Paul Cézanne als Ikone einer ersehnten Besinnung.
Otto Steinerts Foto Schlammweiher 2 (1953) bildet die Vorlage
eines durch Industrie vernichteten Bodens. Doch wie beginnt man noch
einmal? Das Wesen der Malerei, so lautet Tanseys Antwort, liegt im nicht-malbaren
Ursprung. Was kann man alles nicht zeigen!
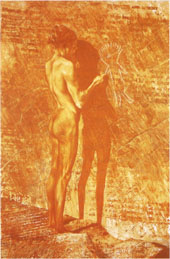 Der
von hinten beleuchtete Ureinwohner vor der Wand ritzt die Gestalt eines
Menschen mit einem "a" im Kopf in den Felsen. Seine Hand mit
dem Stäbchen, die Hand seines Schattens und die Hand des Geritzten
treffen einander in einem Punkt. Darüber sehen wir nochmals drei
Realitätsgrade von Köpfen, den des Menschen, seines Schattens
und seines Werkes, einander berühren. Tansey
bezieht sich auf die seit der Antike bekannte Tradition vom Entstehen
der Malerei: Schattenriß des geliebten Partners und sich spiegelnder
Narziß. Er "illustriert" aber einen Kommentar Derridas
zu einem Zitat von Jean-Jaques Rousseau: "Die Bewegung jenes Stäbchens...
löst sich nicht vom Körper ab. Im Unterschied zum gesprochenen
oder geschriebenen Zeichen trennt sie sich nicht vom begehrenden Körper
dessen, der umreißt, oder vom unmittelbar wahrgenommenen Bild
des anderen. Zweifellos ist auch das ein Bild, was da am Ende des Stäbchens
sich abzeichnet, aber ein Bild, das sich selbst noch nicht ganz von
dem, was es repräsentiert, getrennt hat; das von der Zeichnung
Gezeichnete ist beinahe präsent, leibhaftig in seinem Schatten.
Der Abstand des Schattens oder des Stäbchens ist beinahe nichts."
(Grammatologie) Der
von hinten beleuchtete Ureinwohner vor der Wand ritzt die Gestalt eines
Menschen mit einem "a" im Kopf in den Felsen. Seine Hand mit
dem Stäbchen, die Hand seines Schattens und die Hand des Geritzten
treffen einander in einem Punkt. Darüber sehen wir nochmals drei
Realitätsgrade von Köpfen, den des Menschen, seines Schattens
und seines Werkes, einander berühren. Tansey
bezieht sich auf die seit der Antike bekannte Tradition vom Entstehen
der Malerei: Schattenriß des geliebten Partners und sich spiegelnder
Narziß. Er "illustriert" aber einen Kommentar Derridas
zu einem Zitat von Jean-Jaques Rousseau: "Die Bewegung jenes Stäbchens...
löst sich nicht vom Körper ab. Im Unterschied zum gesprochenen
oder geschriebenen Zeichen trennt sie sich nicht vom begehrenden Körper
dessen, der umreißt, oder vom unmittelbar wahrgenommenen Bild
des anderen. Zweifellos ist auch das ein Bild, was da am Ende des Stäbchens
sich abzeichnet, aber ein Bild, das sich selbst noch nicht ganz von
dem, was es repräsentiert, getrennt hat; das von der Zeichnung
Gezeichnete ist beinahe präsent, leibhaftig in seinem Schatten.
Der Abstand des Schattens oder des Stäbchens ist beinahe nichts."
(Grammatologie)
Tansey
aber widerspricht der Ursprungs-Theorie (weder umreißt der Urmensch
den Schatten der scheidenden Geliebten, noch bildet er sich selbst ab),
und das geritzte Bild hat sich von dem, was es zeigt (dem Menschen),
getrennt, obwohl es das geschriebene Zeichen einschließt. Oder
anders: Er zeigt auch in der Schrift eine nicht die Realität (der
menschlichen Gestalt und der Druckschrift in der Natur der Felswände)
wiederholende Gestaltung. Nach Descartes ist die Welt nicht gelb, nur
weil sie gelb erscheint.
Derrida
kritisiert eine Ansicht, die Claude Lévi-Strauss in seinen Traurigen
Tropen vertritt. Dieser glaubte nämlich in der Schreibstunde,
daß der Häuptling der Nambikwara das den schreibenden Ethnologen
nachahmende Kritzeln als Machtinstrument in der vor diesem Einbruch
der Schrift unschuldigen Gesellschaft mißbrauche. Diese Sicht
gleiche dem naiven Schluß, die Welt sei gelb, nur weil sie so
erscheine (die Nambikwaras waren keinesfalls so friedfertig). Indem
Tansey diese Mal- und Schreibstunde gelb malt, gibt er zu erkennen,
daß das a nicht den Ursprung an sich, sondern nur eine
subjektive Schau einer anfänglichen Schreib- bzw. Malstunde wiedergebe.
Auch aus der Farbgebung weiß der Betrachter, so fand es
nicht statt.
Der
Ursprung der Malerei ist jener Moment, in welchem das Malen entsteht,
sodaß es als Gemaltes nicht sichtbar gemacht werden kann. Tansey
zeigt den Ursprung der Malerei dadurch an, daß er seine Unsichtbarkeit,
seine Unzeigbarkeit vorführt. Er malt den Satz: "Der Ursprung
der Malerei ist der nicht malbare Ursprung." Er liegt nämlich
dort, wo der Ursprung der Sprache zu hören bzw. zu sehen ist.
Wenn
wir das gezeichnete menschliche Bild sehen, sagen wir "Gestalt",
"Mensch", "Gekritzel" usw., aber wir sagen es eigentlich
nicht, sondern denken es im Vergleich mit den beiden anderen Gestalten,
dem Maler und seinem Schatten, die auch drei Realitätsgrade zu
einem Ursprung hin sind: nämlich dem A-Morphen. Die drei Realitätsgrade
reduzieren die Wirklichkeit in einzelnen Schritten vom Körper zum
Schatten zur Zeichnung, die zwar als Gestalt sichtbar bleibt, aber durch
den Buchstaben A, der als Alpha, als Anfang zugleich zum "alpha
privativum", dem verneinenden Präfix wird: aus Gestalt, "morphe",
wird der Begriff "amorphos", das Gestaltlose.
 Doch
das "a" denken und vergleichen wir nicht, sondern sprechen
es als A aus. Der Umriß des Körperbildes bezieht sich auf
andere im Bild, der Laut aber auf uns, die wir ihn aussprechen. Tansey
reflektiert eine weitere Theorie Derridas. Vereinfacht ausgedrückt
war nicht der Laut am Anfang, worauf die Schrift folgte, sondern zuerst
war die Schrift da und dann die Sprache. Doch
das "a" denken und vergleichen wir nicht, sondern sprechen
es als A aus. Der Umriß des Körperbildes bezieht sich auf
andere im Bild, der Laut aber auf uns, die wir ihn aussprechen. Tansey
reflektiert eine weitere Theorie Derridas. Vereinfacht ausgedrückt
war nicht der Laut am Anfang, worauf die Schrift folgte, sondern zuerst
war die Schrift da und dann die Sprache.
Das
A als Zeichen ist zwar ebenso eine Form wie der Körperumriß,
auch wenn der Laut nicht im Bild sichtbar ist, wie die Körper-Realitätsgrade,
doch ist das geschriebene A nicht Abbild wie der gezeichnete Körper,
weil sich der Laut nicht abbilden läßt. Der Buchstabe bezieht
sich als Alpha privativum nicht nur auf die Gestalt, sondern auch auf
sich selbst. Zwar ist er wie jeder andere Buchstabe auch Signifikant
eines Phones, also den Laut bezeichnend, doch als erster Buchstabe verneint
er diesen, sich selbst bzw. das Signifikat, das Bezeichnete zugleich.
es wird eine A-Phonie, die Lautlosigkeit daraus. Der "Beweis":
wir hören ihn nicht.
Wir
müssen den Laut erst aussprechen, um den Unlaut denken zu können.
Wir sehen A und sprechen AAA..A und hören nur den Laut A - erst
wenn wir A als Anfang und Alpha privativum denken, gewinnt dieser gesprochene
Laut auch den Sinn eines am Anfang stehenden Nicht-Lautes, der Stille,
der Stummheit. Eine Trennung ist nötig, man muß sich abkapseln
vom ersten gesprochenen Ton, um ihn als ersten, aus der Nicht-Tonalität
herausgeborenen zu erkennen. Dieses Erkennen des Ursprunges muß
einhergehen mit einer Negation, einem Streichen des A-Lautes.
Dadurch
versiegt das geschriebene A wieder in der Sichtbarkeit, d. h. wir sollen
es nicht sprechen, sondern nur sehen. Der paradoxe Kreis schließt
sich: das A steht als Gesehenes am Anfang der Sprache. Es gibt "keinen
einfachen Ursprung. Denn was reflektiert ist, zweiteilt sich in sich
selbst, es wird ihm nicht nur sein Bild hinzugefügt. Der Reflex,
das Bild, das Doppel zweiteilen, was sie verdoppeln. Der Ursprung der
Spekulation wird eine Differenz. Was sich betrachten läßt,
ist nicht Eins, und es ist das Gesetz der Addition des Ursprunges zu
seiner Repräsentation, des Dings zu seinem Bild, daß Eins
plus Eins wenigstens Drei machen." (Grammatologie)
In
der vielschichtigen Bedeutung des den Ursprung der Malerei (nicht) vorführenden
Bildes a legt Tansey sein Credo dar. Weitere, ebenso negierte
Koordinaten dieses "Selbstbildnisses" sind: Das platonische
Höhlengleichnis: die Schreibweise "differance"
von Derrida; die Schrift-Schöpfungs-Theorie von Jean-Jaques Rousseau.
In dieser kaum mehr zu entziffernden Spekulation deklariert sich Mark
Tansey als Neo-Konzept-Künstler, der mit den Mitteln der Malerei
bisherige Malweisen zugunsten eines, wenn auch unhörbaren, philosophischen
Diskurses verwirft. In seinen Bildern ist das Sichtbare nicht das Gedachte,
das nach und nach von der Natur wie vom Wasser under erasure abgeschliffen
wird.
 Auch
im Bild Johannes des Täufers ist der Hinweis auf die "Schreibstunde"
zu lesen. Dieser Johannes sucht nicht nach der Macht der Schrift,
sondern legt sein Kleid der Schrift (Grammatologie, 2. Kap.)
ab, um den bloßen Körper der Worte zu befreien. Die paradox-prophetische
Predigt dieses seltsamen Heiligen an der Zeitenwende endet vorerst in
der Ablehnung der vielen Texte oder Worte über das spontane Vergessen
der Geschichte (im Sinne de Mans). Immer wieder führt Mark Tansey
die Betrachter an eine Grenze der Fiktion, die zunächst das Sehen
auf das Lesen oder Hören und das Denken "reduziert",
bis man an einem Anfang steht, aus dem heraus nur der (sein) Schöpfungsakt
führen wird - wer aber könnte am Ende all die einmal bedachten
Voraussetzungen wieder vergessen? Auch
im Bild Johannes des Täufers ist der Hinweis auf die "Schreibstunde"
zu lesen. Dieser Johannes sucht nicht nach der Macht der Schrift,
sondern legt sein Kleid der Schrift (Grammatologie, 2. Kap.)
ab, um den bloßen Körper der Worte zu befreien. Die paradox-prophetische
Predigt dieses seltsamen Heiligen an der Zeitenwende endet vorerst in
der Ablehnung der vielen Texte oder Worte über das spontane Vergessen
der Geschichte (im Sinne de Mans). Immer wieder führt Mark Tansey
die Betrachter an eine Grenze der Fiktion, die zunächst das Sehen
auf das Lesen oder Hören und das Denken "reduziert",
bis man an einem Anfang steht, aus dem heraus nur der (sein) Schöpfungsakt
führen wird - wer aber könnte am Ende all die einmal bedachten
Voraussetzungen wieder vergessen?
Literaturhinweise:
Jacques
Derrida: Grammatologie. 1967, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1983,
3. Aufl. 1990
Ders.: Die Schrift und die Differenz. 1967, Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a. M. 1976, 4. Aufl. 1989
Ders.: Randgänge der Philosophie. 1982, Passagen Verlag, Wien 1988
Ders.: Mémoires - für Paul de Man. 1986, Edition Passagen,
Wien 1988
Ders.: Wie nicht sprechen - Verneinungen. 1987, Edition Passagen, Wien
1989
Ders.: Chóra. 1987, Edition Passagen, Wien 1990
Ders.: Wie Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel... Paul de Mans
Krieg - Mémoires II. Edition Passagen, Wien 1988
Paul de Man: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary
Criticism. New York 1971
Ders.: Allegorien des Lesens. Mit einer Einleitung von Werner Hamacher.
1979, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1988
Jörg-Uwe Albig: Ein Denker malt Kritik. In: art Das Kunstmagazin,
Nr. 4/April 1988, S.36-54
Thomas Kellein: Mark Tansey. Mit einem Beitrag von Günter Metken.
Kunsthalle Basel 1990
John Miller: Mark Tansey. In: Artforum International, Summer 1990, S.166

Mark Tansey: Der ungläubige Thomas
|